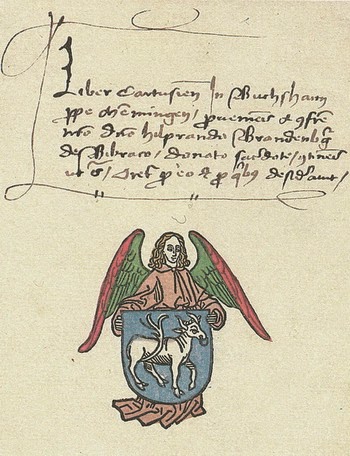Berlin
(ots) - Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker ist im
Alter von 94 Jahren gestorben. Dazu erklärt der Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder:
"Der
Tod von Richard von Weizsäcker erfüllt uns mit tiefer Trauer. Wir
verlieren einen Politiker und Staatsmann, der die parlamentarische
Demokratie in Deutschland über Jahrzehnte maßgeblich geprägt und
Deutschlands Ansehen in der Welt gemehrt hat.
Die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion erinnert sich in besonderer Dankbarkeit an
jene Jahre, in denen Richard von Weizsäcker in unseren Reihen war.
Bereits drei Jahre nach seiner ersten Wahl zum Bundestagsabgeordneten
wurde er 1972 Stellvertretender Vorsitzender unserer Fraktion. Von
1979 bis 1981 übte er das Amt des Vizepräsidenten des Deutschen
Bundestages aus. In dieser Zeit hat er insbesondere die Deutschland-
und Ostpolitik der Fraktion mitgeprägt.
Als
Bundespräsident diente er ab 1984 unserem Land in hervorragender
Weise. Richard von Weizsäcker hat die Versöhnung und Aussöhnung
mit unseren Nachbarn in Europa und mit Israel als eine besondere
Verpflichtung und Aufgabe empfunden und gelebt. Er tat dies im
Bewusstsein der geschichtlichen Verantwortung Deutschlands. Als
Präsident aller Deutschen wirkte er nach der Wiedervereinigung bei
der Herstellung der inneren Einheit Deutschlands mit.
Auch
nach seiner Amtszeit blieb seine Stimme für uns alle wichtig."
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
am 31.01.2015
Samstag, 31. Januar 2015
Bundestagspräsident Lammert würdigt Richard von Weizsäcker:
„Sein Verständnis einer aufgeklärten, reflektierten politischen Kultur wird weiterwirken“
„Mit Richard von Weizsäcker verliert unser
Land eine seiner herausragenden Persönlichkeiten und eine zentrale
Identifikationsfigur“, schreibt Bundestagspräsident Norbert Lammert in
einem Kondolenzbrief an die Frau des verstorbenen Altbundespräsidenten
Richard von Weizsäcker.
In von Weizsäckers Leben spiegele sich fast ein ganzes Jahrhundert deutsche und europäische Geschichte wider. „In seine unvergessene Amtszeit als Bundespräsident fielen mit der Wiederherstellung der deutschen Einheit und dem Ende des Kalten Krieges weltbewegende Ereignisse. Dieser glückliche Aufbruch in ein Zeitalter von Frieden und Freiheit in Europa ist untrennbar auch mit seinem Namen verbunden. Als erster Bundespräsident im geeinten Deutschland gelang es Richard von Weizsäcker die unterschiedlichen Befindlichkeiten der Menschen in Ost und West zu erkennen und zusammenzuführen“, heißt es in Lammerts Brief.
Als Bundespräsident habe von Weizsäcker „wegweisende Worte im Umgang mit der selbst erlebten Geschichte gefunden“, schreibt Lammert. „Seine bedeutende Rede, 40 Jahre nach Kriegsende im Deutschen Bundestag, markierte einen Wendepunkt in der Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels deutscher Vergangenheit“.
Weizsäcker, der „innerhalb des politischen Systems als selbstkritische und mahnende Instanz wirkte“, habe auch großes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger genossen: „sie begegneten ihm bis zuletzt mit tiefer Zuneigung, ja aufrichtiger Bewunderung“, erinnert Lammert.
Der Bundestagspräsident würdigt auch das hohe internationale Ansehen von Weizsäckers, mit dem er es vermocht habe, bei den europäischen Nachbarn Vorbehalte gegenüber der neuen Rolle eines wiedervereinigten Deutschland abzubauen.
„Sein Verständnis einer aufgeklärten, reflektierten politischen Kultur wird weiterwirken“, schreibt Bundestagspräsident Lammert.
In von Weizsäckers Leben spiegele sich fast ein ganzes Jahrhundert deutsche und europäische Geschichte wider. „In seine unvergessene Amtszeit als Bundespräsident fielen mit der Wiederherstellung der deutschen Einheit und dem Ende des Kalten Krieges weltbewegende Ereignisse. Dieser glückliche Aufbruch in ein Zeitalter von Frieden und Freiheit in Europa ist untrennbar auch mit seinem Namen verbunden. Als erster Bundespräsident im geeinten Deutschland gelang es Richard von Weizsäcker die unterschiedlichen Befindlichkeiten der Menschen in Ost und West zu erkennen und zusammenzuführen“, heißt es in Lammerts Brief.
Als Bundespräsident habe von Weizsäcker „wegweisende Worte im Umgang mit der selbst erlebten Geschichte gefunden“, schreibt Lammert. „Seine bedeutende Rede, 40 Jahre nach Kriegsende im Deutschen Bundestag, markierte einen Wendepunkt in der Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels deutscher Vergangenheit“.
Weizsäcker, der „innerhalb des politischen Systems als selbstkritische und mahnende Instanz wirkte“, habe auch großes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger genossen: „sie begegneten ihm bis zuletzt mit tiefer Zuneigung, ja aufrichtiger Bewunderung“, erinnert Lammert.
Der Bundestagspräsident würdigt auch das hohe internationale Ansehen von Weizsäckers, mit dem er es vermocht habe, bei den europäischen Nachbarn Vorbehalte gegenüber der neuen Rolle eines wiedervereinigten Deutschland abzubauen.
„Sein Verständnis einer aufgeklärten, reflektierten politischen Kultur wird weiterwirken“, schreibt Bundestagspräsident Lammert.
Kardinal Marx zum Tod von Bundespräsident a. D. Richard von Weizsäcker
Der
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx,
hat den verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker als
herausragende politische Persönlichkeit gewürdigt. „Richard von
Weizsäcker war der Bundespräsident der deutschen Einheit. Mit hohem
persönlichen Engagement hat er an der Umsetzung der Einheit unseres
Landes mitgewirkt. Er ist auf die Menschen zugegangen, um ihre
Hoffnungen und Ängste der Wiedervereinigung zu verstehen: So konnte er
Politik und Gesellschaft Hinweise geben, die Menschen auf dem Weg der
Versöhnung mitzunehmen. Insbesondere war Richard von Weizsäcker die
Verständigung auf dem europäischen Kontinent ein Herzensanliegen. Wo der
Dialog nicht funktionierte, hat er Gesprächsmöglichkeiten eröffnet.“
Als
Präsident des Evangelischen Kirchentages und als Mitglied der Synode
der Evangelischen Kirche in Deutschland sei Richard von Weizsäcker auch
die Ökumene ein Anliegen gewesen. Für ihn war das gemeinsame Suchen der
Kirchen nach gesellschaftlichem Engagement von Bedeutung, so Kardinal
Marx. „Wer dem früheren Bundespräsidenten begegnete, spürte das Anliegen
des Verstorbenen: Er wollte das christliche Erbe unseres Landes
lebendig halten. Richard von Weizsäcker war ein Mann des offenen Wortes,
der aus der Kraft des Gebets gelebt und gehandelt hat“, so Kardinal
Marx.
Kölner Rosemontagszug ohne Charlie Hebdo?
Es hat in den letzten Tagen
viele Diskussionen zu einen Motivwagen gegeben, der für den Kölner
Rosemontagszug gestaltet worden war, und nun offenbar nicht
zugelassen wird. Er ist der inzwischen weltweit wirkenden Problematik
um das Satiremagazin Charlie Hebdo und deren getöteten Herausgeber
und Redakteuren gewidmet. Und der ebenso heiter wie anschaulich mahnt
, Unstimmigkeiten und Differenzen tunlichst auf satirische oder
geistvolle, nie aber auf gewaltsame Art auszutragen. Wer an dieser
Problematik interessiert ist, konnte sich anhand zahlreicher
Presseberichte informieren und seine eigenen Gedanken dazu machen.
So, wie auch ich das versuchte.
Ich gebe zu, dass ich damit meine Schwierigkeiten hatte. Und schon angesichts der zeitlichen Nähe zu den schrecklichen Ereignissen in Paris der Meinung war, dass mit diesen Motivwagen das Gedenken konterkariert würde. Und sich militante Gegner von Charlie Hebdo erneut provoziert fühlen könnten. Vielleicht eine vorschnelle Meinung, wie mir nach einer willkommenen Diskussion darüber schien. Schließlich hat das sinnvoll gestaltete Motiv grundsätzliche Bedeutung. Und die Zeitnähe zu den bezuggenommenen Ereignissen die Dringlichkeit dieser erkennbaren Mahnung umso deutlicher werden lässt.
Was immer auch ein weitergehender Meinungsaustausch gebracht haben könnte, auf die Befindung der Verantwortlichen für den Kölner Rosemontagszug hätte sie keinerlei Bedeutung. Weiterer Überlegungen wurde ich allerdings auch enthoben durch den Deutschlandfunk. Der ließ in einem Bericht den Präsidenten des Kölner Karnevalsvereins „Rote Funken“, Heinz Günther Hunold zu dieser Problematik zu Wort kommen, der ganz klar feststellte (Zitat): „Wir lassen uns die Meinungsfreiheit, die Gedankenfreiheit, die Narrenfreiheit nicht verbieten." (Ende des Zitats). Er vergaß lediglich die „Entscheidungsfreiheit“ zu erwähnen, wie ich meine. Mir bleibt bestenfalls noch zu überlegen, auf was alles man die „Narrenfreiheit“ noch ausdehnen müsste!?
Ich gebe zu, dass ich damit meine Schwierigkeiten hatte. Und schon angesichts der zeitlichen Nähe zu den schrecklichen Ereignissen in Paris der Meinung war, dass mit diesen Motivwagen das Gedenken konterkariert würde. Und sich militante Gegner von Charlie Hebdo erneut provoziert fühlen könnten. Vielleicht eine vorschnelle Meinung, wie mir nach einer willkommenen Diskussion darüber schien. Schließlich hat das sinnvoll gestaltete Motiv grundsätzliche Bedeutung. Und die Zeitnähe zu den bezuggenommenen Ereignissen die Dringlichkeit dieser erkennbaren Mahnung umso deutlicher werden lässt.
Was immer auch ein weitergehender Meinungsaustausch gebracht haben könnte, auf die Befindung der Verantwortlichen für den Kölner Rosemontagszug hätte sie keinerlei Bedeutung. Weiterer Überlegungen wurde ich allerdings auch enthoben durch den Deutschlandfunk. Der ließ in einem Bericht den Präsidenten des Kölner Karnevalsvereins „Rote Funken“, Heinz Günther Hunold zu dieser Problematik zu Wort kommen, der ganz klar feststellte (Zitat): „Wir lassen uns die Meinungsfreiheit, die Gedankenfreiheit, die Narrenfreiheit nicht verbieten." (Ende des Zitats). Er vergaß lediglich die „Entscheidungsfreiheit“ zu erwähnen, wie ich meine. Mir bleibt bestenfalls noch zu überlegen, auf was alles man die „Narrenfreiheit“ noch ausdehnen müsste!?
Freitag, 30. Januar 2015
Seniorenbegegnungszentrum geschlossen
Gestern
hatte ich hier meine Meinung zur Schließung des
Senioren-Begegnungszentrums in NDH-Nord geäußert, heute kommt von
der Nordhäuser SPD eine Mitteilung, die dieser Problematik gewidmet
ist. Darin heißt es:
Heute
schlossen sich die Pforten des Seniorenbegegnungszentrums in
Nordhausen. Dazu sagt Andreas Wieninger (SPD): Es ist schon ein
bemerkenswerter Vorgang, wenn ohne Beschlüsse in den zuständigen
Stadtratsgremien eine durch die Stadt betriebene Einrichtung
geschlossen wird. Dazu hat die SPD Fraktion auch die Kommunalaufsicht
angerufen. Dabei richtet sich die Kritik der SPD Fraktion nicht gegen
eine Sanierung oder ein neues Konzept für das SBZ, sondern gegen die
durch die Rathausspitze verfügte Schließung ohne konkrete
Vorstellungen von der Zukunft des Hauses. Sagt Wieninger. Da
gibt es Vorstellungen oder Teilinformationen, welche u.a. mal von
einem Mehrgenerationenhaus, mal von einem neuen Träger oder anderem
Eigentümer sprechen. Außer den allgemeinen und vagen Informationen
in vorberatenden Ausschüssen fehlen konkrete Beratungen und
Beschlüsse in den zuständigen Stadtratsgremien zur Sanierung und
weiteren Zukunft des Hauses. Auch kann von einer Weiterführung aller
bisherigen Angebote in Nordhausen Ost nicht die Rede sein. Wie wir
erfahren haben, wird nach der heute erfolgten Schließung die
Senioren Gymnastikgruppe weiterhin die Räume nutzen. Wie dies bei
einer laufenden Sanierung funktionieren soll, ist uns ein Rätsel.
Kosten für Energie, Heizung usw fallen weiterhin an.
Vor
diesem Hintergrund appellieren wir an die Rathausspitze, die
Schließung auszusetzen und alle Angebote im SBZ weiter zu führen
bis Beschlüsse durch die Stadtratsgremien getroffen wurden.
Informationen ersetzen keine Beteiligung der Betroffenen und
Stadträte. Sagt Wieninger abschließend.
Es wird weiter geflunkert und spekuliert
Ich bin, wie ich meine, ein
aufmerksamer Zeitungsleser – zumindest soweit es deren
Internet-Ausgaben betrifft – aber bei aller Mühe vermag ich
trotzdem nicht zu sagen, was genau der Ausstieg Griechenlands aus der
EU für Griechenland und Europa bedeuten würde. Ich wundere mich
auch, dass die EU angeblich überrascht und verärgert ist, weil
Griechenland seine bisherige aufgezwungene Sparpolitik aufgibt,
obwohl doch der nunmehrige Ministerpräsident Alexis Tsipras schon
im Wahlkampf ankündigte, dass er das tun würde!? Die Medien
jedenfalls bringen mir keine Aufschlüsse.
Nicht viel anders geht es mir mit dem Ukraine-Komplex: ich kann mir nach den Medien- oder Zeitungsberichten kein klares Bild machen über Kampfhandlungen der Ukrainischen Armee oder der Separatisten, ich weiß nichts über Art und Umfang der Unterstützung der Separatisten durch Russland und ich habe keine Ahnung, wie sich die Sanktionen der Europäischen Gemeinschaft auf Russland auswirken. Aber ebenso wenig ihre Folgen auf die deutsche Wirtschaft. Und schließlich habe ich auch keine Antwort auf die Frage, ob nun der Islam zu Frankreich oder zu Deutschland gehört. Über alles wurde und wird viel geschrieben, aber nirgendwo klare Vorstellungen dafür oder dagegen vermittelt. Apropos Islam: Henryk M. Bröder schrieb gestern in der „Welt“ über „Der normale Wahnsinn des Islam“. Und ich weiß noch nicht einmal genügend über den normalen, den gelebten Islam. Ich stehe zwar zu, dass die Presse keine wirklichen Antworten hat, aber nur zu schreiben ohne wirkliche Aussagen machen zu können, ist meines Erachtens reiner Populismus.
Und wenn ich mich von diesen Themen abwende und mich über Vorgänge im Lande informieren will, lande ich unweigerlich früher oder später bei „Pegida“. Aber auch darüber wird nur viel be- und geschrieben, aber wenig wirklich ausgesagt. Kein Wunder deshalb, dass laut einer Umfrage, die „Focus“ bei dem Institut INSA in Auftrag gegeben hat, jeder zweite Deutsche findet , dass Medien über die Pegida-Demonstrationen nicht objektiv berichten. Besonders Nichtwähler (71 Prozent) und AfD-Anhänger (79 Prozent) sind laut Focus dieser Auffassung (Auszug): „Auch bei Wählern der Parteien Die Linke (52 Prozent) und der FDP (51 Prozent) fällt das Urteil über die Medien-Berichterstattung mehrheitlich negativ aus.“(Ende des Auszugs). Die Meinungsforscher von INSA befragten für „Focus“ über 2.019 Bürger im Zeitraum vom 16. bis 19. Januar 2015. Dazu zwei Beispiele:
Das Team um den Politikwissenschaftler Hans Vorländer hatte für eine Studie den Angaben zufolge bei drei Demonstrationen im Dezember und Januar rund 400 Teilnehmer befragt. Auf der Grundlage der Angaben entwarfen die Wissenschaftler das Bild des typischen Demonstranten: Dieser verfügt demnach über ein für sächsische Verhältnisse leicht überdurchschnittliches Nettoeinkommen, ist 48 Jahre alt und männlich. Er gehört keiner Konfession an, ist keiner Partei verbunden und stammt aus Dresden oder Sachsen. Es gehen laut der Untersuchung auch keineswegs vor allem Rentner und Arbeitslose auf die Straße: 70 Prozent der befragten Teilnehmer sind demnach berufstätig.(T-Online vom 14.01.15) Und laut Politikprofessor Werner Patzelt von der TU Dresden ist dort Grund der Demonstrationen das konservative Umfeld (Auszug): „Die Stadt ist eine der letzten CDU-regierten Metropolen. Auch das Umland gilt als konservativ. In eher linken Städten wie Köln, Hamburg oder Berlin habe Pegida kaum eine Chance. Als weiteren Grund sieht Patzelt die ostdeutsche Angst vor Entmündigung. Viele fühlten sich demnach abgehängt und nicht repräsentiert. Das wecke Erinnerungen an die DDR. "Schon damals hat das politische System nicht auf die Menschen gehört und sich nur zum Nationalfeiertag beklatschen lassen", sagt der Politologe. Deshalb sei der Pegida-Slogan "Wir sind das Volk" auch als Weckruf zu verstehen: "Das soll heißen: Uns gibt es auch noch, hört auf uns, ignoriert uns nicht", glaubt Patzelt.“(Spiegel vom 18.01.) Trotzdem heißt es in der Presse stereotyp, die Demonstranten seien eindeutig rechtslastig, islamfeindlich und vielfach Hooligans. Patzelt: „Zudem ist das schnelle Wachstum von Pegida auch mit einer Trotzreaktion zu erklären. Viele Teilnehmer fühlen sich zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt. Der Nazi-Vorwurf habe dazu beigetragen, dass sich viele Menschen dann erst recht Pegida angeschlossen haben, sagt der Politologe.
Und nun liest man in der Presse unter dem Titel: „Was aus Pegida werden könnte“ (Deutsche Welle am 29.01.), die Führung der Pegida-Bewegung würde sich schrittweise auflösen. (Auszug): „Pegida-Sprecherin Kathrin Oertel und fünf weitere Mitglieder der Führung der islamfeindlichen Bewegung Pegida legten am Dienstagabend bei einer Sitzung alle Funktionen und Ämter nieder. Die nächste Demonstration ist abgesagt“ (Ende des Auszugs). Und sofort wird spekuliert. „Eine große Zukunft für Pegida sehen Politikwissenschaftler und Soziologen nicht, was aus Pegida werden könnte.“ Nirgendwo Fakten, nirgends klare Aussagen, nur Vermutungen und Spekulationen. Meinen letzten Eintrag dazu schloss ich mit der Aussage: „Über den weiteren Verlauf könnte man spekulieren. Oder halt abwarten.“ Die Presse kann dazu einen Unterhaltungsbeitrag leisten, zuverlässige Informationen bietet sie nicht. Leider.
Nicht viel anders geht es mir mit dem Ukraine-Komplex: ich kann mir nach den Medien- oder Zeitungsberichten kein klares Bild machen über Kampfhandlungen der Ukrainischen Armee oder der Separatisten, ich weiß nichts über Art und Umfang der Unterstützung der Separatisten durch Russland und ich habe keine Ahnung, wie sich die Sanktionen der Europäischen Gemeinschaft auf Russland auswirken. Aber ebenso wenig ihre Folgen auf die deutsche Wirtschaft. Und schließlich habe ich auch keine Antwort auf die Frage, ob nun der Islam zu Frankreich oder zu Deutschland gehört. Über alles wurde und wird viel geschrieben, aber nirgendwo klare Vorstellungen dafür oder dagegen vermittelt. Apropos Islam: Henryk M. Bröder schrieb gestern in der „Welt“ über „Der normale Wahnsinn des Islam“. Und ich weiß noch nicht einmal genügend über den normalen, den gelebten Islam. Ich stehe zwar zu, dass die Presse keine wirklichen Antworten hat, aber nur zu schreiben ohne wirkliche Aussagen machen zu können, ist meines Erachtens reiner Populismus.
Und wenn ich mich von diesen Themen abwende und mich über Vorgänge im Lande informieren will, lande ich unweigerlich früher oder später bei „Pegida“. Aber auch darüber wird nur viel be- und geschrieben, aber wenig wirklich ausgesagt. Kein Wunder deshalb, dass laut einer Umfrage, die „Focus“ bei dem Institut INSA in Auftrag gegeben hat, jeder zweite Deutsche findet , dass Medien über die Pegida-Demonstrationen nicht objektiv berichten. Besonders Nichtwähler (71 Prozent) und AfD-Anhänger (79 Prozent) sind laut Focus dieser Auffassung (Auszug): „Auch bei Wählern der Parteien Die Linke (52 Prozent) und der FDP (51 Prozent) fällt das Urteil über die Medien-Berichterstattung mehrheitlich negativ aus.“(Ende des Auszugs). Die Meinungsforscher von INSA befragten für „Focus“ über 2.019 Bürger im Zeitraum vom 16. bis 19. Januar 2015. Dazu zwei Beispiele:
Das Team um den Politikwissenschaftler Hans Vorländer hatte für eine Studie den Angaben zufolge bei drei Demonstrationen im Dezember und Januar rund 400 Teilnehmer befragt. Auf der Grundlage der Angaben entwarfen die Wissenschaftler das Bild des typischen Demonstranten: Dieser verfügt demnach über ein für sächsische Verhältnisse leicht überdurchschnittliches Nettoeinkommen, ist 48 Jahre alt und männlich. Er gehört keiner Konfession an, ist keiner Partei verbunden und stammt aus Dresden oder Sachsen. Es gehen laut der Untersuchung auch keineswegs vor allem Rentner und Arbeitslose auf die Straße: 70 Prozent der befragten Teilnehmer sind demnach berufstätig.(T-Online vom 14.01.15) Und laut Politikprofessor Werner Patzelt von der TU Dresden ist dort Grund der Demonstrationen das konservative Umfeld (Auszug): „Die Stadt ist eine der letzten CDU-regierten Metropolen. Auch das Umland gilt als konservativ. In eher linken Städten wie Köln, Hamburg oder Berlin habe Pegida kaum eine Chance. Als weiteren Grund sieht Patzelt die ostdeutsche Angst vor Entmündigung. Viele fühlten sich demnach abgehängt und nicht repräsentiert. Das wecke Erinnerungen an die DDR. "Schon damals hat das politische System nicht auf die Menschen gehört und sich nur zum Nationalfeiertag beklatschen lassen", sagt der Politologe. Deshalb sei der Pegida-Slogan "Wir sind das Volk" auch als Weckruf zu verstehen: "Das soll heißen: Uns gibt es auch noch, hört auf uns, ignoriert uns nicht", glaubt Patzelt.“(Spiegel vom 18.01.) Trotzdem heißt es in der Presse stereotyp, die Demonstranten seien eindeutig rechtslastig, islamfeindlich und vielfach Hooligans. Patzelt: „Zudem ist das schnelle Wachstum von Pegida auch mit einer Trotzreaktion zu erklären. Viele Teilnehmer fühlen sich zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt. Der Nazi-Vorwurf habe dazu beigetragen, dass sich viele Menschen dann erst recht Pegida angeschlossen haben, sagt der Politologe.
Und nun liest man in der Presse unter dem Titel: „Was aus Pegida werden könnte“ (Deutsche Welle am 29.01.), die Führung der Pegida-Bewegung würde sich schrittweise auflösen. (Auszug): „Pegida-Sprecherin Kathrin Oertel und fünf weitere Mitglieder der Führung der islamfeindlichen Bewegung Pegida legten am Dienstagabend bei einer Sitzung alle Funktionen und Ämter nieder. Die nächste Demonstration ist abgesagt“ (Ende des Auszugs). Und sofort wird spekuliert. „Eine große Zukunft für Pegida sehen Politikwissenschaftler und Soziologen nicht, was aus Pegida werden könnte.“ Nirgendwo Fakten, nirgends klare Aussagen, nur Vermutungen und Spekulationen. Meinen letzten Eintrag dazu schloss ich mit der Aussage: „Über den weiteren Verlauf könnte man spekulieren. Oder halt abwarten.“ Die Presse kann dazu einen Unterhaltungsbeitrag leisten, zuverlässige Informationen bietet sie nicht. Leider.
Selbsterfahrung in der MARKTPASSAGE
Nordhausen
(FHPN) Am 6. Februar ab 15 Uhr führen Studierende der Hochschule
Nordhausen eine Selbsterfahrungs-Aktion im Rahmen des interdisziplinären
Projekts "Teilhabe in Nordhausen" durch. Stattfinden wird die Aktion in
der ECHTEN NORDHÄUSER MARKTPASSAGE.
Studierende
des Studiengangs „Heilpädagogik“ an der Hochschule Nordhausen wollen
den Besuchern der ECHTEN NORDHÄUSER MARKTPASSAGE die Möglichkeit bieten,
ihren Einkauf mal auf eine gänzlich andere Art und Weise zu erleben.
„Wechseln Sie Ihre Perspektive und erfahren Sie Ihre alltäglichen
Besorgungen zum Beispiel aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers. Gemeinsam
informieren wir über das vielfältige Thema der Barrieren im Alltag“, so
die Studierenden. Unterstützt wird die Aktion vom Haus der Gesundheit
und der ECHTEN NORDHÄUSER MARKTPASSAGE.
„Manon“-Premiere muss verschoben werden
Die
für heute Abend geplante Premiere der Oper „Manon“ im Theater
Nordhausen muss wegen der Erkrankung der Hauptdarstellerin nun doch
verschoben werden. Trotz Aufbietung aller Kräfte ist es leider nicht
möglich, den Premierentermin mit einem Gast als Manon zu halten.
Regisseur Toni Burkhardt und Generalmusikdirektor Markus Frank haben
gestern Abend bis kurz vor Mitternacht mit einer Einspringerin aus
Berlin geprobt und alles versucht, um die Premiere zu retten.
Doch
die Partie ist so groß und anspruchsvoll, dass die Theaterleitung die
Entscheidung getroffen hat, die Premiere zu verschieben. „Unsere
Besucherinnen und Besucher erwarten mittlerweile zu Recht ein hohes
Niveau unserer Opernproduktionen. Eine bestimmte Qualität wollen wir
nicht unterschreiten, nur um einen Premierentermin mit aller Gewalt zu
halten“, sagte Intendant Lars Tietje. „Es wäre nicht seriös, unseren
Besucherinnen und Besuchern eine nicht ausreichend geprobte Premiere zu
zeigen. Wir hoffen sehr auf deren Verständnis dafür.“
Die
Premiere der Oper von Jules Massenet findet nun am Sonntag, 8. Februar,
um 18 Uhr statt. Besucher, die Karten für die ursprüngliche Premiere
hat, können diese an der Theaterkasse (Tel. 0 36 31/98 34 52) gegen
Karten für den 8. Februar oder eine der weiteren Vorstellungen von
„Manon“ am 21.02. um 19.30 Uhr, am 25.03. um 15 Uhr, am 27.03. um 19.30
Uhr und am 19.04. um 14.30 Uhr tauschen.
Die Ausstellung mit Theaterfotografien von Roland Obst wird trotzdem am heutigen Abend eröffnet.
Forschungsarbeit über Stasi-Kreisdienststelle Nordhausen erstellt
Nordhausen
(psv) Im Auftrag der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU-Bund Berlin) hat Dr.
Hanna Labrenz-Weiß, wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und Forschung, die
Kreisdienststelle der Staatssicherheit Nordhausen untersucht und ein
Manuskript für ein 220-seitiges Buch mit 40 Seiten Anhang erstellt.
Über
die Erkenntnisse ihrer Forschungsarbeit informierte sie unlängst
Oberbürgermeister Dr. Klaus Zeh bei einem Gespräch im Nordhäuser
Rathaus.
„Wir
sind es den Opfern schuldig, für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen“,
sagte Oberbürgermeister Klaus Zeh. Auch der kommenden Generation müsse
das Herrschaftssystem
der DDR erklärt werden. Er begrüßte es deshalb sehr, dass diese
Forschungsarbeit weiter über die konkreten Macht- bzw. Abhängigkeitsverhältnisse regionaler Herrschaftsformen des MfS aufklärt.
„Da
der Kreis Nordhausen eine enorme wirtschaftliche und auch strategische
Bedeutung innerhalb der DDR hatte - das Produktionsaufkommen der
Nordhäuser Betriebe IFA, NOBAS,
Schachtbau, Hochbau, Hydrogeologie, oder Fernmeldewerk nahm
beispielsweise den zweiten Platz im Bezirk hinter dem Kreis Erfurt ein -
spiegelte sich dies auch in der organisatorischen und personellen
Ausstattung der Kreisdienstelle des Ministeriums für Staatssicherheit
(MfS) wider“, erklärt Dr. Hanna Labrenz-Weiß. Deren Daten genau zu
erfassen, habe zunächst am Anfang aller Analysevorhaben gestanden.
Die
Stasi-Kreisdienststelle Nordhausen habe sich besonders angesichts des
guten Aktenbestandes, ebenso aber auch wegen der volkswirtschaftlich
herausgehobenen Stellung
des untersuchten Feldes, für eine derartige Studie in besonderem Maße
geeignet. Erforscht wurde sie in ihrer Organisationsstruktur, nach der
Struktur ihrer jeweiligen Arbeitsweisen, erweitert durch ein
Analyseverfahren mit der Untersuchung ihres offiziellen
Personalbestandes sowie des inoffiziellen Netzes
„Das
aus meiner Sicht wichtigste Kapitel, das sich auf ein Studium der Akten
von 1950 bis 1989 stützt, trägt den Arbeitstitel:
Herrschaft und Gesellschaft im Kreis Nordhausen“, erklärte sie weiter.
Hierzu wurden alle IM-Akten aus den 50er Jahren und jeweils 100 bis 150
aus den 60er, 70er und 80er Jahren ausgewertet. Darüber hinaus wurden
alle aktiven GMS-Vorgänge (GMS= Gesellschaftliche
Mitarbeiter für Sicherheit, die in leitenden Funktionen in den
Betrieben arbeiteten und keine Verpflichtung unterschrieben) untersucht.
Dieses
breite Aktenstudium zeige, wie die SED-Herrschaft im Alltag
funktionierte, welche Disziplinierungsmechanismen griffen
bzw. scheiterten, auf welche Formen von Zustimmung, Anpassung oder
Widersetzen sie trafen und welche Rolle die lokale Staatssicherheit als
ein zentrales Element des DDR-Herrschaftssystems dabei spielte, so die
Buchautorin. Dieses Kapitel ihrer Studien belege
aber auch, dass Spitzeldienste nicht die Regel, sondern eher die
Ausnahmen (hauptsächlich in den 50er Jahren) waren, und dass die Zahl
der geführten informellen Mitarbeiter oder der gesellschaftlichen
Mitarbeiter für Sicherheit nicht der tatsächlichen Zahl
der inoffiziellen Mitarbeiter entspricht. So wurden im Jahre 1988 zum
Beispiel im Auftrag der
Auswertungs- und Kontrollgruppe der Bezirksverwaltung Erfurt
fast 50% der IM-Vorgänge sofort archiviert, da sie nur als „Karteileichen“ geführt wurden.
Die
Vorstellung der Forschungsergebnisse durch Frau Dr. Hanna Labrenz –
Weiß, BStU, ist in Kooperation mit dem Verein „Gegen Vergessen – Für
Demokratie e.V.“ und der
FLOHBURG |Das Nordhausen Museum, am 21. April 2015, um 19 Uhr, in der
Flohburg geplant.
Foto: Dr. Hanna Labrenz-Weiß (Foto: privat)
Marica Bodrožic erhält Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2015
Schreiben zwischen den europäischen
Kulturen
Marica Bodrožic erhält den mit 15.000 € dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2015. Die 1973 in Svib (im heutigen Kroatien) geborene Schriftstellerin leiste mit ihren epischen und essayistischen Werken einen maßgeblichen kulturellen Beitrag zur Neuordnung Europas nach 1989, so die Begründung der Jury.
Von der Transformation eines Europas der Nationen in eine multipolare Welt und von dem gefährdeten Weg der Freiheit in den südost- und mitteleuropäischen Staaten erzähle sie auf eine eindringliche, realistische und zugleich poetisch-phantasievolle Weise, so in den Erzählungen Tito ist tot (2002) und Der Windsammler (2007), in den Romanen Das Gedächtnis der Libellen (2010), Kirschholz und alte Gefühle (2012) und Mein weißer Frieden (2014) sowie in dem Essay Sterne erben, Sterne färben. Meine Ankunft in Wörtern (2007). Marica Bodrožic literarischer Blick in die europäische Raum- und Zeitgeschichte durchbreche starre Freund-Feind-Bilder, um dahinter Probleme von Arbeitsmigranten, multiethnische und religiöse Konflikte sichtbar zu machen. Das Schreiben zwischen den Kulturen sei selten so nuancenreich und so bildkräftig praktiziert worden wie in Bodrožiæs Büchern.
„Im Prozess des zusammenwachsenden Europas baut Marica Bodrožic auf die integrative Erinnerungs- und Gestaltungskraft der Literatur“, erklärt der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D., Dr. Hans-Gert Pöttering, der den Literaturpreis am 31. Mai 2015 in Weimar verleihen wird. Die Laudatio auf Marica Bodrožic hält der deutsche Literaturwissenschaftler und Gründungsdirektor des „Center for Anglo-American Cultural Relations“ in London, Prof. Dr. Rüdiger Görner.
Der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung wird seit 1993 an Autoren verliehen, die der Freiheit das Wort geben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören u.a. Sarah Kirsch, Hilde Domin, Günter de Bruyn, Thomas Hürlimann, Hartmut Lange, Louis Begley, Herta Müller, Wulf Kirsten, Daniel Kehlmann, Ralf Rothmann, Uwe Tellkamp, Cees Nooteboom, Arno Geiger, Tuvia Rübner, Martin Mosebach und Rüdiger Safranski.
Der unabhängigen Jury gehören an: Prof. Dr. Gerhard Lauer (Universität Göttingen) als Vorsitzender, Prof. Dr. Oliver Jahraus (Ludwig-Maximilians-Universität München), Christine Lieberknecht MdL (Ministerpräsidentin a.D. des Freistaats Thüringen), Felicitas von Lovenberg (Leiterin Literatur, Frankfurter Allgemeine Zeitung), Ijoma Mangold (Die Zeit) sowie Prof. Dr. Birgit Lermen (Universität zu Köln) als Ehrenmitglied.
Marica Bodrožic erhält den mit 15.000 € dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2015. Die 1973 in Svib (im heutigen Kroatien) geborene Schriftstellerin leiste mit ihren epischen und essayistischen Werken einen maßgeblichen kulturellen Beitrag zur Neuordnung Europas nach 1989, so die Begründung der Jury.
Von der Transformation eines Europas der Nationen in eine multipolare Welt und von dem gefährdeten Weg der Freiheit in den südost- und mitteleuropäischen Staaten erzähle sie auf eine eindringliche, realistische und zugleich poetisch-phantasievolle Weise, so in den Erzählungen Tito ist tot (2002) und Der Windsammler (2007), in den Romanen Das Gedächtnis der Libellen (2010), Kirschholz und alte Gefühle (2012) und Mein weißer Frieden (2014) sowie in dem Essay Sterne erben, Sterne färben. Meine Ankunft in Wörtern (2007). Marica Bodrožic literarischer Blick in die europäische Raum- und Zeitgeschichte durchbreche starre Freund-Feind-Bilder, um dahinter Probleme von Arbeitsmigranten, multiethnische und religiöse Konflikte sichtbar zu machen. Das Schreiben zwischen den Kulturen sei selten so nuancenreich und so bildkräftig praktiziert worden wie in Bodrožiæs Büchern.
„Im Prozess des zusammenwachsenden Europas baut Marica Bodrožic auf die integrative Erinnerungs- und Gestaltungskraft der Literatur“, erklärt der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parlaments a.D., Dr. Hans-Gert Pöttering, der den Literaturpreis am 31. Mai 2015 in Weimar verleihen wird. Die Laudatio auf Marica Bodrožic hält der deutsche Literaturwissenschaftler und Gründungsdirektor des „Center for Anglo-American Cultural Relations“ in London, Prof. Dr. Rüdiger Görner.
Der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung wird seit 1993 an Autoren verliehen, die der Freiheit das Wort geben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören u.a. Sarah Kirsch, Hilde Domin, Günter de Bruyn, Thomas Hürlimann, Hartmut Lange, Louis Begley, Herta Müller, Wulf Kirsten, Daniel Kehlmann, Ralf Rothmann, Uwe Tellkamp, Cees Nooteboom, Arno Geiger, Tuvia Rübner, Martin Mosebach und Rüdiger Safranski.
Der unabhängigen Jury gehören an: Prof. Dr. Gerhard Lauer (Universität Göttingen) als Vorsitzender, Prof. Dr. Oliver Jahraus (Ludwig-Maximilians-Universität München), Christine Lieberknecht MdL (Ministerpräsidentin a.D. des Freistaats Thüringen), Felicitas von Lovenberg (Leiterin Literatur, Frankfurter Allgemeine Zeitung), Ijoma Mangold (Die Zeit) sowie Prof. Dr. Birgit Lermen (Universität zu Köln) als Ehrenmitglied.
IMK: Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt intakt
Die
positive Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt ist trotz des für die
Jahreszeit üblichen Anstiegs der Arbeitslosigkeit intakt. Darauf
weist das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)
in der Hans-Böckler-Stiftung hin. Die Forscher rechnen damit, dass
die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt 2015 um 280.000
Personen oder plus 0,7 Prozent zunehmen wird. Die Zahl der
Arbeitslosen dürfte nach der aktuellen IMK-Prognose um 64.000 im
Jahresdurchschnitt zurückgehen. Die Quote läge dann bei 6,5
Prozent.*
Dass die Arbeitslosigkeit im Januar weniger stark angestiegen ist als im Durchschnitt der Vorjahre, saisonbereinigt leicht sank und deutlich unter dem Wert vor einem Jahr liegt, ist für den wissenschaftlichen-Direktor des IMK, Prof. Dr. Gustav A. Horn, ein Indiz dafür, dass die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns am 1. Januar keine messbaren Auswirkungen auf die Beschäftigung hatte. „Das Muster, das wir am Arbeitsmarkt sehen, ist für die aktuelle konjunkturelle Situation ganz typisch“, erklärt Horn. „Ansonsten kann man nur der Einschätzung des BA-Vorsitzenden Frank-Jürgen Weise zustimmen: Für fundierte Aussagen über die Wirkung des Mindestlohns ist es schlicht noch zu früh.“
Rainer Jung Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Hans-Böckler-Stiftung
Eine
Mitteilung des idw – wissenschaftlichen Dienstes am 29.01.2015
Donnerstag, 29. Januar 2015
Wie immer ein fröhliches Hallo allen, die diese mail mit den Anhängen erhalten....
.
. . und ich gehörte diesmal
dazu. Wobei mich wundert, dass dieser Bericht als Mail doch an die
hiesige Presse gegangen ist. Und ich mich mit meinen Blog nicht dazu
zähle. Und sie kommt als
Antwort des Vorsitzenden des Kunsthaus Meyenburg-Fördervereins, Dr. Wolfgang Pientka, offenbar als Antwort auf die Verwunderung der Fördervereins-Mitglieder, warum bei ihren Veranstaltungen – bisher zumindest – nie ein Vertreter der Presse den Einladungen folgte. Dr. Pientkas Vermutung: „Man kann nicht erwarten, dass die wenigen Vertreter der Presse - ob digital oder in 'Papierform' - zu allen Veranstaltungen gehen. Dies ist nicht möglich und auch nicht zu schaffen... Und das Spektrum reicht eben vom "Kaninchenzüchter" über den "Fußballverein" bis hin zum wie hier "Kunsthaus".
Mit diesem Vorspann, der den „in die Tiefe gehenden Journalismus“ anschaulich definiert, soll es hier sein Bewenden haben. Immerhin: was den Zeitungen – oder denen, die sich als solche bezeichnen – an Berichten angeboten wird, wird von deren Redaktionen „aufgeschnappt“ wie Happen von Vierbeinern. Und in einer Weise „verarbeitet“, die zum Beispiel die wenigstens dann die kulturelle Bedeutung der jeweiligen Veranstaltung erkennen lässt. Für die die Zeitungen keinen Berichterstatter freistellen konnten.
Hier also „Kunst & Kaffe“ gestern in Kunsthaus Meyenburg
Interesse an Exlibris ungebrochen groß
Vortrag in KUNST & KAFFEE begeisterte
Die Sitze im KUNSTHAUS-KELLER waren bis auf einen oder zwei Stühle besetzt und für den anschließenden Kuchen und Kaffee mussten Stühle und Gedecke zugestellt werden – so groß war das Interesse an dem Vortrag über Geschichte, Gestaltung, Druckverfahren der Buchzeichen – „Exlibris“ – von der Römerzeit bis heute. Wie auch in der Presse angekündigt – hier auch vom KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN ein ausdrücklicher Dank - begann die Fortsetzung der Reihe KUNST&KAFFEE in 2015 mit einer Art ‚Paukenschlag‘. Der Leiterin des Kunsthauses, Frau Susanne Hinsching gelang es einen weiten Rahmen zu spannen – vom ersten bekannten Holzschnitt-Exlibris von Hildebrand Brandenburg – siehe Abbildung -, dessen Entstehungszeit dem Ende des 15. Jahrhunderts zugerechnet wird bis hin zu Exlibris von Klinger und Vogeler, alle mit sehr anschaulichen Abbildungen begleitet und erläutert. Für die meisten der Zuhörer war es neu, dass fast alle bekannten Maler auch die Kunst des Exlibris pflegten, ob Albrecht Dürer, Lucas Cranach dem Älteren oder auch der neueren Zeit zuzurechnende wie Klinger, Kubin, Dix, Barlach bis hin zu Andy Warhol. Und wer denkt schon an Exlibris, wenn sich momentan die Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen auf die vier
großen Ausstellungen zu Ehren von Lucas Cranach vorbereiten. Oder an Ludwig Richter, den die meisten der älteren Leser noch aus den Illustrationen der Märchenbücher der Gebrüder Grimm kennen. Eines seiner Exlibris sei hier eingefügt – ein Musterbeispiel der Kunst des Biedermeier – erste Hälfte des 19. Jahrhunderts - und einer Schilderung der bürgerlichen Geborgenheit. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Liebfrauenkapelle im benachbarten Stolberg als Vorlage für sein berühmtes Bild „Brautzug im Frühling“ diente. Das Bild zu betrachten in der Gemäldegalerie „Neue Meister“ in Dresden - die Kapelle am Ortsausgang Stolberg links am Wanderweg zum Josephskreuz, heute genutzt als Friedhofskapelle. Im Vortrag wurden aber nicht nur typische Vertreter der ‚Exlibris-Kunst‘ gezeigt und erläutert, sondern auch die Techniken– vom Holzschnitt im Mittelalter über den Kupferstich als die Drucktechnik des Barock bis hin zur Radierung, die dann zum Ende des 19. Jahrhunderts diese Kunstform weiterführte. Hier sei Max Klinger als Begründer der modernen Radierkunst erwähnt. Eine absolute Blüte erlebte das Buchzeichen im Jugendstil, dessen Kunstform mit den dekorativ geschwungenen Linien sowie den flächenhaften floralen Ornamenten auch heute den Betrachter berührt und bezaubert. So sind Werke
des Jugendstils – ob in der Baukunst in den Stadtführungen bis hin zur Buchillustration in Museen– immer wieder Magneten für die Besucher – vielleicht ein weiteres Thema für KUNST&KAFFEE im Kunsthaus-Keller? Dem zweiten und dritten „K“ dieser Reihe wie ‚Kuchen und Kaffee‘ in KUNST&KAFFEE wurde nach dem Vortrag gut zugesprochen, wobei die Gespräche der Teilnehmer etwas beeinträchtigt wurden durch die nicht optimale Akustik. Dieses kleine Manko bildete ein sofort geführtes Gespräch zwischen der Leitung des Kunsthauses und dem KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN mit dem Ziel, hier kurzfristig Lösungen zu finden, die einerseits mit möglichst wenig Kosten verbunden sind und andererseits die Raumakustik verbessern helfen. Ideen und vor allem Sponsoren sind gefragt und jede Hilfe ist in dieser Zeit des knappen Geldes willkommen.
Dr. Wolfgang R. Pientka Vorsitzender des KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN
Antwort des Vorsitzenden des Kunsthaus Meyenburg-Fördervereins, Dr. Wolfgang Pientka, offenbar als Antwort auf die Verwunderung der Fördervereins-Mitglieder, warum bei ihren Veranstaltungen – bisher zumindest – nie ein Vertreter der Presse den Einladungen folgte. Dr. Pientkas Vermutung: „Man kann nicht erwarten, dass die wenigen Vertreter der Presse - ob digital oder in 'Papierform' - zu allen Veranstaltungen gehen. Dies ist nicht möglich und auch nicht zu schaffen... Und das Spektrum reicht eben vom "Kaninchenzüchter" über den "Fußballverein" bis hin zum wie hier "Kunsthaus".
Mit diesem Vorspann, der den „in die Tiefe gehenden Journalismus“ anschaulich definiert, soll es hier sein Bewenden haben. Immerhin: was den Zeitungen – oder denen, die sich als solche bezeichnen – an Berichten angeboten wird, wird von deren Redaktionen „aufgeschnappt“ wie Happen von Vierbeinern. Und in einer Weise „verarbeitet“, die zum Beispiel die wenigstens dann die kulturelle Bedeutung der jeweiligen Veranstaltung erkennen lässt. Für die die Zeitungen keinen Berichterstatter freistellen konnten.
Hier also „Kunst & Kaffe“ gestern in Kunsthaus Meyenburg
Interesse an Exlibris ungebrochen groß
Vortrag in KUNST & KAFFEE begeisterte
Die Sitze im KUNSTHAUS-KELLER waren bis auf einen oder zwei Stühle besetzt und für den anschließenden Kuchen und Kaffee mussten Stühle und Gedecke zugestellt werden – so groß war das Interesse an dem Vortrag über Geschichte, Gestaltung, Druckverfahren der Buchzeichen – „Exlibris“ – von der Römerzeit bis heute. Wie auch in der Presse angekündigt – hier auch vom KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN ein ausdrücklicher Dank - begann die Fortsetzung der Reihe KUNST&KAFFEE in 2015 mit einer Art ‚Paukenschlag‘. Der Leiterin des Kunsthauses, Frau Susanne Hinsching gelang es einen weiten Rahmen zu spannen – vom ersten bekannten Holzschnitt-Exlibris von Hildebrand Brandenburg – siehe Abbildung -, dessen Entstehungszeit dem Ende des 15. Jahrhunderts zugerechnet wird bis hin zu Exlibris von Klinger und Vogeler, alle mit sehr anschaulichen Abbildungen begleitet und erläutert. Für die meisten der Zuhörer war es neu, dass fast alle bekannten Maler auch die Kunst des Exlibris pflegten, ob Albrecht Dürer, Lucas Cranach dem Älteren oder auch der neueren Zeit zuzurechnende wie Klinger, Kubin, Dix, Barlach bis hin zu Andy Warhol. Und wer denkt schon an Exlibris, wenn sich momentan die Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen auf die vier
großen Ausstellungen zu Ehren von Lucas Cranach vorbereiten. Oder an Ludwig Richter, den die meisten der älteren Leser noch aus den Illustrationen der Märchenbücher der Gebrüder Grimm kennen. Eines seiner Exlibris sei hier eingefügt – ein Musterbeispiel der Kunst des Biedermeier – erste Hälfte des 19. Jahrhunderts - und einer Schilderung der bürgerlichen Geborgenheit. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Liebfrauenkapelle im benachbarten Stolberg als Vorlage für sein berühmtes Bild „Brautzug im Frühling“ diente. Das Bild zu betrachten in der Gemäldegalerie „Neue Meister“ in Dresden - die Kapelle am Ortsausgang Stolberg links am Wanderweg zum Josephskreuz, heute genutzt als Friedhofskapelle. Im Vortrag wurden aber nicht nur typische Vertreter der ‚Exlibris-Kunst‘ gezeigt und erläutert, sondern auch die Techniken– vom Holzschnitt im Mittelalter über den Kupferstich als die Drucktechnik des Barock bis hin zur Radierung, die dann zum Ende des 19. Jahrhunderts diese Kunstform weiterführte. Hier sei Max Klinger als Begründer der modernen Radierkunst erwähnt. Eine absolute Blüte erlebte das Buchzeichen im Jugendstil, dessen Kunstform mit den dekorativ geschwungenen Linien sowie den flächenhaften floralen Ornamenten auch heute den Betrachter berührt und bezaubert. So sind Werke
des Jugendstils – ob in der Baukunst in den Stadtführungen bis hin zur Buchillustration in Museen– immer wieder Magneten für die Besucher – vielleicht ein weiteres Thema für KUNST&KAFFEE im Kunsthaus-Keller? Dem zweiten und dritten „K“ dieser Reihe wie ‚Kuchen und Kaffee‘ in KUNST&KAFFEE wurde nach dem Vortrag gut zugesprochen, wobei die Gespräche der Teilnehmer etwas beeinträchtigt wurden durch die nicht optimale Akustik. Dieses kleine Manko bildete ein sofort geführtes Gespräch zwischen der Leitung des Kunsthauses und dem KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN mit dem Ziel, hier kurzfristig Lösungen zu finden, die einerseits mit möglichst wenig Kosten verbunden sind und andererseits die Raumakustik verbessern helfen. Ideen und vor allem Sponsoren sind gefragt und jede Hilfe ist in dieser Zeit des knappen Geldes willkommen.
Dr. Wolfgang R. Pientka Vorsitzender des KUNSTHAUS MEYENBURG FÖRDERVEREIN
Gast aus Berlin rettet Premiere
Johanna Krumin singt für Elena Puszta
Sopranistin Johanna Krumin aus Berlin rettet die morgige Premiere der Oper „Manon“ am Theater
Nordhausen. Die Sängerin, die die Partie fest in ihrem Repertoire hat, springt kurzfristig für die erkrankte Elena Puszta ein. Für das Ensemble bedeutet das zusätzliche Proben, damit der Gast aus Berlin am Premierenabend bestens vorbereitet auf die Bühne des Theaters Nordhausen gehen und das Publikum mit Gesang und Spiel begeistern kann.
Karten für die Premiere von „Manon“ am 30. Januar um 19.30 Uhr und die nächsten Vorstellungen am 8. Februar um 18 Uhr und am 21. Februar um 19.30 Uhr gibt es noch an der Theaterkasse (Tel. 0 36 31/98 34 52), im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.
Foto Johanna Krumin: Jens Roetzsch
Sopranistin Johanna Krumin aus Berlin rettet die morgige Premiere der Oper „Manon“ am Theater
Nordhausen. Die Sängerin, die die Partie fest in ihrem Repertoire hat, springt kurzfristig für die erkrankte Elena Puszta ein. Für das Ensemble bedeutet das zusätzliche Proben, damit der Gast aus Berlin am Premierenabend bestens vorbereitet auf die Bühne des Theaters Nordhausen gehen und das Publikum mit Gesang und Spiel begeistern kann.
Karten für die Premiere von „Manon“ am 30. Januar um 19.30 Uhr und die nächsten Vorstellungen am 8. Februar um 18 Uhr und am 21. Februar um 19.30 Uhr gibt es noch an der Theaterkasse (Tel. 0 36 31/98 34 52), im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.
Foto Johanna Krumin: Jens Roetzsch
Bringt Kommunalaufsicht Klärung?
In der TA-Lokalausgabe vom
24.01. lese ich, dass die SPD-Fraktion des Nordhäuser Stadtrates in
Sachen Senioren-Begegnungszentrum in NDH-Nord die Kommunalaufsicht
angerufen hat, um dessen Zukunft zu klären. Mich interessiert diese
Einrichtung mehr im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung
als aus eigenem Erleben, etwa durch Teilnahme an dortigen
Veranstaltungen. Und ich war auch nicht Teilnehmer der
Informationsveranstaltung, in der es um die vorgeblich zeitweilige
Schließung dieser „zweiten Heimat für Senioren“ ging. Dafür
kenne ich inzwischen teils recht unterschiedliche Vermutungen und
Annahmen von zahlreichen SeniorInnen selbst. Das Ansinnen der SPD an
die Kommunalaufsicht könnte nun Klarheit bringen über die
tatsächliche Zukunft dieses Begegnungszentrums. Sollte sie
allerdings zu dem Ergebnis kommen, dass ein privater Träger die
Einrichtung übernehmen kann, könnte es auch dann noch
Unsicherheiten geben. Stünde eine Kommunalwahl vor der Tür, wäre
der Verlauf wohl schon bisher ein anderer gewesen.
Theaterfotos im Foyer
Seit
genau zehn Jahren sorgt er dafür, dass es professionelle Bilder von
Produktionen des Theaters Nordhausen gibt: Roland Obst, hauptberuflich
Fotograf bei der Thüringer Allgemeinen. Am morgigen Freitag wird um
18.45 Uhr vor der Premiere der Oper „Manon“ im Foyer des Theaters eine
Ausstellung seiner
Theaterfotografien eröffnet. Sie ist gleichzeitig
eine Zeitreise durch das letzte Jahrzehnt am Theater Nordhausen –
Theaterfreunde werden sich an viele der Inszenierungen erinnern.
Die
erste Oper, die Ronald Obst fotografisch festhielt, war „Tosca“, über
die die Thüringer Allgemeine seinerzeit eine Serie brachte. Seitdem
folgten über 40 Fotoserien, in denen er Inszenierungen im Großen Haus
und im Theater unterm Dach des Theaters Nordhausen abgebildet hat.
Verwendung fanden die Bilder als offizielle Pressefotos zu den Stücken
sowie in Programmheften und weiteren Publikationen des Theaters.
Auch
die Fotos von der aktuellen Opernproduktion „Manon“ hat der erfahrene
Pressefotograf gemacht. Nach der Vernissage vor der Premiere am 30.
Januar um 18.45 Uhr kann die Ausstellung jeweils eine Stunde vor Beginn
jeder Vorstellung besichtigt werden.
Foto:
v. li. TA-Fotograf Roland Obst bespricht mit Steffen Kasperski und
Claudia Pollety vom Theater Nordhausen die Aufhängung der Bilder für die
Fotoausstellung; Foto: Birgit Susemihl
Arbeitgeberpräsident Kramer: Leistungsschwächeren Jugendlichen bessere Chancen geben
 Berlin, 29. Januar 2015. Zu den heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen erklärt Arbeitgeberpräsident Kramer:
Berlin, 29. Januar 2015. Zu den heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen erklärt Arbeitgeberpräsident Kramer: Trotz weltweiter konjunktureller Unsicherheiten ist die Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland weiterhin positiv. Auch in diesem Jahr ist mit einer neuen Rekordbeschäftigung zu rechnen. In einigen Branchen und Regionen treten Fachkräfteengpässe auf.
Insbesondere im naturwissenschaftlich-technischen Bereich werden sowohl Fachkräfte mit Hochschulabschluss als auch mit Berufsabschluss gesucht. Die beiden Bereiche gegeneinander auszuspielen, lenkt von den eigentlichen bildungspolitischen Herausforderungen ab: Wir haben jährlich immer noch rund 50.000 Schulabbrecher, fast 20 Prozent nicht ausbildungsreife Jugendliche und Abbruchquoten an den Hochschulen von durchschnittlich fast 30 Prozent.
Leistungsschwächere und benachteiligte Jugendliche rücken zu Recht in den Fokus der Arbeitsmarktpolitik. Es ist richtig und wichtig, dass das Bundesarbeitsministerium kurzfristig Vorschläge für Gesetzesänderungen zu ausbildungsbegleitenden Hilfen und assistierter Ausbildung vorgelegt hat. So können schon im Ausbildungsjahr 2015/2016 bessere Rahmenbedingungen für die Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen gelten. Mehr junge Menschen erhalten die Chance auf eine Ausbildung, Ausbildungsabbrüche können verhindert und mehr Betriebe für die Ausbildung leistungsschwächerer oder benachteiligter Jugendlicher gewonnen werden.
Kreisumlage soll stabil bleiben
Nordhausen (pln 23/15).
Zu einer Beratung haben sich gestern
haupt- und ehrenamtliche Bürgermeister im Landratsamt getroffen. Die
1. Beigeordnete Jutta Krauth hatte die Ortschefs eingeladen, um den
Haushaltsentwurf für 2015 in seinen Eckwerten vorzustellen. Der
Kreistag wird am 10. Februar in erster Lesung darüber beraten. "Wir
wollen an dem Kompromiss zur Kreisumlage, den wir mit den Kommunen
vereinbart haben, festhalten", erläutert Jutta Krauth den
stabilen Umlagesatz, der weiterhin bei 37,27 % liegen soll. Die
Zuweisungen vom Land für den übertragenen Wirkungskreis seien
momentan nicht auskömmlich, da die Auftragskostenpauschale nicht
ausreiche. "Es gibt allerdings Signale von der neuen
Landesregierung, in der Überarbeitung des Kommunalen
Finanzausgleichs nicht mehr nur die Einwohnerzahlen, sondern auch
Fallzahlen stärker zu berücksichtigen. Dafür werden wir uns in
Erfurt einsetzen", sagte Jutta Krauth.
Auch mit einem anderen Thema der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung hat sich die Bürgermeisterberatung beschäftigt. Die Kreisräte werden vier Beschlussvorlagen zu naturschutzfachlichen Vorkaufsrechten beraten, die der Landkreis bei verschiedenen Grundstücken im Südharzer Zechsteingürtel wahrnehmen könnte. Die betroffenen Grundstücke wollen in drei Fällen gipsabbauende Firmen erwerben. Auch der Nordhäuser Stadtrat hat zu dieser Thematik bereits getagt und auch das Land, das ebenfalls ein Vorkaufsrecht hat, wird sich damit noch im Februar auseinandersetzen. Auf der Agenda der Bürgermeisterberatung stand auch die Zunahme der Asylbewerberzahlen. Gegenwärtig hat der Landkreis 315 Flüchtlinge und Asylbewerber untergebracht, größtenteils verteilt in Wohnungen und auch in der Gemeinschaftsunterkunft. Das Land hat angekündigt, dass der Landkreis in diesem Jahr mit 377 Erstanträgen von Asylbewerber rechnen kann. "Für mich ist dies eine Gemeinschaftsaufgabe im Landkreis, die Flüchtlingen so integrativ und sozial wie möglich in Wohnungen in verschiedenen Städten und Gemeinden unterzubringen", so Jutta Krauth, die die gute Zusammenarbeit mit den Wohnungsgesellschaften betonte. Aufgrund der steigenden Zahlen werden jetzt auch private Vermieter angesprochen. Außerdem informierte die Landkreisverwaltung die Bürgermeister über den neuen Tourismusverband Südharz Kyffhäuser, der sich vor gut zwei Wochen gegründet hat, und die Fortsetzung des LEADER-Programms, wozu im März ein breiter öffentlicher Diskussionsprozess starten wird, um Schwerpunkte der Förderung im ländlichen Raum zu beschreiben.
Auch mit einem anderen Thema der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung hat sich die Bürgermeisterberatung beschäftigt. Die Kreisräte werden vier Beschlussvorlagen zu naturschutzfachlichen Vorkaufsrechten beraten, die der Landkreis bei verschiedenen Grundstücken im Südharzer Zechsteingürtel wahrnehmen könnte. Die betroffenen Grundstücke wollen in drei Fällen gipsabbauende Firmen erwerben. Auch der Nordhäuser Stadtrat hat zu dieser Thematik bereits getagt und auch das Land, das ebenfalls ein Vorkaufsrecht hat, wird sich damit noch im Februar auseinandersetzen. Auf der Agenda der Bürgermeisterberatung stand auch die Zunahme der Asylbewerberzahlen. Gegenwärtig hat der Landkreis 315 Flüchtlinge und Asylbewerber untergebracht, größtenteils verteilt in Wohnungen und auch in der Gemeinschaftsunterkunft. Das Land hat angekündigt, dass der Landkreis in diesem Jahr mit 377 Erstanträgen von Asylbewerber rechnen kann. "Für mich ist dies eine Gemeinschaftsaufgabe im Landkreis, die Flüchtlingen so integrativ und sozial wie möglich in Wohnungen in verschiedenen Städten und Gemeinden unterzubringen", so Jutta Krauth, die die gute Zusammenarbeit mit den Wohnungsgesellschaften betonte. Aufgrund der steigenden Zahlen werden jetzt auch private Vermieter angesprochen. Außerdem informierte die Landkreisverwaltung die Bürgermeister über den neuen Tourismusverband Südharz Kyffhäuser, der sich vor gut zwei Wochen gegründet hat, und die Fortsetzung des LEADER-Programms, wozu im März ein breiter öffentlicher Diskussionsprozess starten wird, um Schwerpunkte der Förderung im ländlichen Raum zu beschreiben.
„Wirtschaft ist so rational wie der Kauf eines Ferraris.“
Schon wiederholt habe ich
hier im Rahmen des „idw – wissenschaftlichen Dienstes“ Beiträge
der privaten Universität Witten/Herdecke eingestellt. Hier nun geht
es um ein Buch von Prof. Dr. Birger P. Priddat, eines Lehrenden
dieser Universität, in dem der Autor die Ideologie der rationalen
Kaufentscheidungen beendet – Überredung, Vertrauen und Freunde
entscheiden mit. Und es vermittelt Vorstellungen.

„Economics of persuasion“ – Ökonomie der Überredung heißt das neue Buch von Prof. Dr. Birger P. Priddat. Es beginnt mit einem Wasserkocher – der alte ist verkalkt und abgewrackt, ein neuer soll her. Bestens vorbereitet mit allen Ergebnissen von Stiftung Warentest im Kopf begibt sich der Homo oekonomicus ins Geschäft, zutiefst zur Rationalität entschlossen. Im Regal warten 16 verschiedene Exemplare auf den armen Tropf und alle Überlegungen zu Preislimit und Energieverbrauch verdampfen wie der letzte Tropfen im Kocher – was rational richtig wäre ist hässlich wie die Nacht und eine Beleidigung für das schlafverkrustete Auge am Morgen. Der rationale Neokortex wird augenblicklich vom emotionalen limbischen System des Hirns überstimmt und der teure, aber schönere Kocher wird gekauft. Soviel zur Theorie, dass alle Transaktionen in der Wirtschaft rational entschieden werden. „Das hat eine nette Logik, die wir alle gerne an der Wirkung sehen würden, stimmt aber mit der Realität nicht im mindesten überein“, sagt Priddat.
Und legt nach: „In der Bank, bei Anlage oder Kredit, geht es um Vertrauen, denn im Zweifel kann ich das Angebot doch nicht nachrechnen und wenn ich unabhängig beraten werden wollte, würde ich mir einen unabhängigen Berater suchen. So aber akzeptiere ich, dass der Banker mir das Produkt mit der meisten Rendite für ihn oder die Bank andreht, weil ich ihm vertraue.“ Den Vorgang nennt Priddat „Nichtwissenbasierte Beziehung“. Oder noch zugespitzter: Wie rechtfertigen sich astronomische Preise in Luxusrestaurants? „Satt macht mich die Pommesbude nebenan auch.“ Der Geschmack, lautet dann das Argument der Gourmets. Doch geht es wirklich darum? „Es geht um eine Community: Meine Freunde haben mir das empfohlen, der Gastro-Kritiker meiner Zeitung war begeistert – Ich entscheide doch nicht nach rationalen, sondern nach zutiefst emotionalen Gesichtspunkten“, erklärt Priddat an diesem Beispiel und weitet die Analyse aus: „Werbung alleine reicht nicht, um mich für ein Produkt einzunehmen. Da müssen Stimmen aus meiner Umgebung – Freunde, Netzwerke, Nachbarn – dazukommen, damit eine Resonanz entsteht und ich mich wirklich zu einem Kauf überreden lasse.“ Die gegenseitige Beobachtung ist somit wichtigstes Argument für oder gegen einen Kauf. „Der Markt ist eine rhetorische Veranstaltung und der Preis spielt nur die zweite Geige“, bringt er seine These auf den Punkt. Deutung und Bedeutung statt Konkurrenz und Preis.
Zum Schluss macht Priddat einen Schritt zu einer neuen ökonomischen Theorie: Alleine die Tatsache, dass es zu wirtschaftlichen Transaktionen kommt, bestimme den Markt, nicht das Motiv. „Natürlich geht es um Nutzen für Käufer und/oder Verkäufer, aber Rationalität spielt dabei selten eine Rolle.“
Birger P. Priddat: Economics of persuasion
Ökonomie zwischen Markt, Kommunikation und Überredung
Metropolis, 2015, 477 Seiten, ISBN 978-3-7316-1046-5
Zur Home-Uni des Autors:
Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung 1983 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: Als Modelluniversität mit rund 2.000 Studierenden in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform der klassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immer Hand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.
Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.

„Economics of persuasion“ – Ökonomie der Überredung heißt das neue Buch von Prof. Dr. Birger P. Priddat. Es beginnt mit einem Wasserkocher – der alte ist verkalkt und abgewrackt, ein neuer soll her. Bestens vorbereitet mit allen Ergebnissen von Stiftung Warentest im Kopf begibt sich der Homo oekonomicus ins Geschäft, zutiefst zur Rationalität entschlossen. Im Regal warten 16 verschiedene Exemplare auf den armen Tropf und alle Überlegungen zu Preislimit und Energieverbrauch verdampfen wie der letzte Tropfen im Kocher – was rational richtig wäre ist hässlich wie die Nacht und eine Beleidigung für das schlafverkrustete Auge am Morgen. Der rationale Neokortex wird augenblicklich vom emotionalen limbischen System des Hirns überstimmt und der teure, aber schönere Kocher wird gekauft. Soviel zur Theorie, dass alle Transaktionen in der Wirtschaft rational entschieden werden. „Das hat eine nette Logik, die wir alle gerne an der Wirkung sehen würden, stimmt aber mit der Realität nicht im mindesten überein“, sagt Priddat.
Und legt nach: „In der Bank, bei Anlage oder Kredit, geht es um Vertrauen, denn im Zweifel kann ich das Angebot doch nicht nachrechnen und wenn ich unabhängig beraten werden wollte, würde ich mir einen unabhängigen Berater suchen. So aber akzeptiere ich, dass der Banker mir das Produkt mit der meisten Rendite für ihn oder die Bank andreht, weil ich ihm vertraue.“ Den Vorgang nennt Priddat „Nichtwissenbasierte Beziehung“. Oder noch zugespitzter: Wie rechtfertigen sich astronomische Preise in Luxusrestaurants? „Satt macht mich die Pommesbude nebenan auch.“ Der Geschmack, lautet dann das Argument der Gourmets. Doch geht es wirklich darum? „Es geht um eine Community: Meine Freunde haben mir das empfohlen, der Gastro-Kritiker meiner Zeitung war begeistert – Ich entscheide doch nicht nach rationalen, sondern nach zutiefst emotionalen Gesichtspunkten“, erklärt Priddat an diesem Beispiel und weitet die Analyse aus: „Werbung alleine reicht nicht, um mich für ein Produkt einzunehmen. Da müssen Stimmen aus meiner Umgebung – Freunde, Netzwerke, Nachbarn – dazukommen, damit eine Resonanz entsteht und ich mich wirklich zu einem Kauf überreden lasse.“ Die gegenseitige Beobachtung ist somit wichtigstes Argument für oder gegen einen Kauf. „Der Markt ist eine rhetorische Veranstaltung und der Preis spielt nur die zweite Geige“, bringt er seine These auf den Punkt. Deutung und Bedeutung statt Konkurrenz und Preis.
Zum Schluss macht Priddat einen Schritt zu einer neuen ökonomischen Theorie: Alleine die Tatsache, dass es zu wirtschaftlichen Transaktionen kommt, bestimme den Markt, nicht das Motiv. „Natürlich geht es um Nutzen für Käufer und/oder Verkäufer, aber Rationalität spielt dabei selten eine Rolle.“
Birger P. Priddat: Economics of persuasion
Ökonomie zwischen Markt, Kommunikation und Überredung
Metropolis, 2015, 477 Seiten, ISBN 978-3-7316-1046-5
Zur Home-Uni des Autors:
Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung 1983 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: Als Modelluniversität mit rund 2.000 Studierenden in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform der klassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immer Hand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.
Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.
Vortrag zum Themenjahr Reformation und Bild
Am 12. Februar, in der Stadtbibliothek:
Nordhausen
(psv) Am Donnerstag, dem 12. Februar, um 19.30 Uhr, findet im Lesesaal
der Stadtbibliothek ein Lichtbildervortrag
zum Themenjahr Reformation und Bild mit Dr. Bodo Seidel statt. Unter
dem Motto „Luthers Comics“ zeigt er, wie in einer Zeit, in der rund 90
Prozent der
Menschen in Mitteleuropa nicht lesen und schreiben können,
mit karikaturähnlichen Illustrationen beim
Buch- und Bibeldruck gearbeitet wurde.
„In
der Reformationszeit war der Buchdruck erst rund ein Jahrhundert alt.
Es gab im frühesten Bibeldruck allerdings schon
Illustrationen. Fast jeder kennt die Holzschnitte der Lutherbibel aus
der Cranach-Werkstatt“, erklärt Bodo Seidel. Gleichzeitig waren
sogenannte Einblattdrucke im Umlauf. Das waren die Flugschriften der
Reformation. Sie hatte nicht selten unbarmherzigste Darstellungen
der gegnerischen Seite zur Absicht. Da kommt der Papst schlecht weg.
Aber auch die katholische Seite bediente sich dieser karikaturähnlichen
Drucke, um sich zu verteidigen und die Gegenseite bloß zustellen. In der
Reformationszeit gab es einen regelrechten
Kampf der „Comics“. Die bildliche Darstellung wurde verwendet, und die
Autoren wollten offenkundig keine Grenzen kennen. Aufgrund des fast
flächendeckenden Analphabetismus in dieser zeit konnte Schrift da nicht
ankommen, Bilder schon.
Der Eintritt ist frei.
( Foto: Reproduktion, B.Seidel)
Morgen um 16 Uhr vor dem Rathaus:
„Rüdgsdorfer
Schweiz“: Stadtratsvorsitzende und Bürgerinitiative laden zum
öffentlichen Spendenaufruf
Nordhausen
(psv) Mit Blick auf
die Nutzung des Vorkaufsrechts für Gips-Flächen durch die Stadt
Nordhausen im Naturschutzgebiet „Rüdigsdorfer Schweiz“ laden
die Nordhäuser Stadtratsvorsitzende Inge Klaan und die
Bürgerinitiative „Gegen einen Gipsabbau in der Rüdigsdorfer
Schweiz“ zu einem öffentlichen Spendenaufruf ein für Morgen,
Donnerstag, den 29. Januar, um 16 Uhr vor das Rathaus.
Dazu
erklärt die Stadtratsvorsitzende:
„Ich würde
mich freuen, wenn dieser Spendenaufruf zugleich als ein Signal der
fraktionsübergreifenden Einigkeit im Thema wird. Deshalb wäre es
gut, wenn alle Fraktionen des Stadtrates hinter diesem Aufruf stehen.
Darum habe ich alle Fraktionsvorsitzenden gebeten.“
Mittwoch, 28. Januar 2015
Der Theaterjugendclub tanzt
„Shades of Colours“ hat am 7. Februar Premiere im Theater unterm Dach
Im
Februar beginnt die Saison des Theaterjugendclubs. Den Premierenreigen
eröffnet am 7. Februar um 19.30 Uhr im Theater unterm Dach das
Tanztheaterstück „Shades of Colours“.
In
„Shades of Colours“ lädt der Jugendclub dazu ein, Farben mit und durch
die Augen der Jugendlichen zu sehen, und zeigt, wie inspirierend Farbe
sein kann. Die neun Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 14
und 19 Jahren zeigen ihren persönlichen Zugang zu Farbe, was sie damit verbinden und wie Farbe sie anregt, Bewegungen zu finden, die all das ausdrücken.
und 19 Jahren zeigen ihren persönlichen Zugang zu Farbe, was sie damit verbinden und wie Farbe sie anregt, Bewegungen zu finden, die all das ausdrücken.
Unter
der Leitung von Tanz- und Theaterpädagogin Daniela Zinner ist ein Stück
entstanden, das sich mit dem Facettenreichtum von Farben
auseinandersetzt. Die Choreographien haben die Jugendlichen selbst
geschaffen. Und wenn es um Farben geht, darf natürlich auch die bildende
Kunst nicht zu kurz kommen: Die Jugendlichen kreieren während der
Vorstellung kleine Bilder.
„Shades
of Colours“ ist nicht die erste Tanztheaterproduktion der Jugendlichen:
Bereits seit mehreren Jahren beschäftigt sich ein Teil der
Jugendclubber mit Tanz. In der vergangenen Spielzeit beeindruckten sie
in „Lost
in Puschkin“ mit ihrer ganz eigenen Sicht auf Puschkins Versroman „Eugen Onegin“.
in Puschkin“ mit ihrer ganz eigenen Sicht auf Puschkins Versroman „Eugen Onegin“.
Karten
für die Premiere von „Shades of Colours“ am 7. Februar um 18 Uhr im
Theater unterm Dach und die nächsten Vorstellungen am 15. Februar um 18
Uhr und am 3. März um 19.30 Uhr gibt es an der Theaterkasse (Tel. 0 36
31/98 34 52), im Internet unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.
Fotos: Erste Ausschnitte aus „Shades of Colours“ wurden bereits in „Stückwerk No 12“ präsentiert; Foto: Jessica Piper
13. Nordhäuser Kindergarten-Sporttag
Nordhausen (pln 22/15).
Am kommenden Mittwoch laden der Landkreis und der Kreissportbund zum
13. Mal zum Kita-Sporttag ein. Die Vorschulkinder aus Kindergärten im
ganzen Landkreis treffen sich in der Wiedigsburghalle, um gemeinsam an
verschiedenen Stationen zu turnen. Der Kita-Sporttag beginnt um 9 Uhr
und auch alle Eltern sind herzlich eingeladen, ihren Kindern
zuzuschauen. Der Kindergarten-Sporttag bietet den baldigen ABC-Schützen
einen kleinen Einblick in den künftigen Schulsport. Auch im diesem Jahr
erwarten der Landkreis und der Kreissportbund bis zu 500 Vorschulkinder
in der Wiedigsburghalle. In verschiedenen Aufgaben können die
zukünftigen Erstklässler ihre motorischen Fähigkeiten, Ausdauer, Kraft,
Beweglichkeit und Koordination testen. Der sportlichsten Kita winkt der
Titel „Fittester Kindergarten“ mit dem „Turnböckchen“ als Wanderpokal.
Initiative „EIN HARZ“ trifft sich mit regionaler Wirtschaft
Nordhausen / Clausthal-Zellerfeld (psv)
Nach dem sich
bereits in der vergangenen Woche die Arbeitsgruppe „Infrastruktur“
getroffen hatte, fand in dieser Woche auf Initiative der Bürgermeister
der Harzregion („EIN HARZ“), in Clausthal-Zellerfeld
erstmals ein Treffen mit Vertretern der regionalen Wirtschaft statt.
Zu
dieser Runde hatten Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk (Goslar) und
Bürgermeister Klaus Becker (Osterode) eingeladen. Die Stadt Nordhausen
war
durch Oberbürgermeister Dr. Klaus Zeh vertreten.
Bei
diesem Treffen informierten die Oberbürgermeister aus Goslar und
Nordhausen die Vertreter der Wirtschaft über das Anliegen der
Initiative, den
Harz unabhängig von Länder-, Kreis- und Stadtgrenzen als Gesamtregion
aufzustellen.
In
den einzelnen Arbeitsgruppen (Verkehrsinfrastruktur, Imagebildung,
rechtliche Bedingungen und Bildung) werden derzeit die Ziele und
Aufgabenstellungen
formuliert und für die nächste große Runde aller Beteiligten
Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte Ende Februar in
Sangerhausen erarbeitet.
Einhellig
sprachen sich die Vertreter der Wirtschaft aus den Landkreisen
Nordhausen, Osterode, Goslar, Sangerhausen und Harzkreis für ein
gemeinsames
Vorgehen und Interesse aus. Die Wirtschaft des Harzes ist bereits über
die Ländergrenzen hinweg aktiv, und sieht sich gerade daher als einen
Motor dieser Initiative für einen gemeinsamen Harz. Vorteile brächte
dies für alle Seiten. Einig waren sich alle Teilnehmer,
dass die Dachmarke „Harz“ besser vermarktet werden müsse. Neben dem
Abbau von Bürokratien und der gemeinsamen Einwerbung von Fördermitteln,
ist ein gemeinsames Auftreten der Region Harz auch ein wirtschaftlicher
Wettbewerbsvorteil. Ein starker Standort mit
Strahlkraft ins Land, das ist das erklärte Ziel der Wirtschaft. Dieses
Selbstbewusstsein gilt es zu formulieren, zu leben und damit
beispielsweise im Bereich Fachkräfte gegen andere Regionen zu punkten.
Mit
dieser Unterstützung und dem gemeinsamen Auftreten aller drei
Bundesländer, können vor allem überregionale Projekte, wie die
Verkehrsinfrastruktur
eines Harzringes, im Bundesverkehrswegeplan voran gebracht werden. Die
Kommunalpolitiker werden dieses Projekt Harzring für das Treffen in
Sangerhausen vorbereiten, um dann über die jeweiligen Ministerien aller
drei Bundesländer einen gemeinsamen Zugang zum
Bundesverkehrswegeplan zu erreichen.
Ein
weiteres Treffen mit den Vertretern der regionalen Wirtschaft ist
bereits im März geplant. Hier werden die ersten Schritte abgeglichen und
weitere
vereinbart werden.
Arbeitgeberpräsident Kramer: Wir brauchen ein Belastungsmoratorium und den Abbau von Bürokratie
 Berlin, 28. Januar 2015. Zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung erklärt Arbeitgeberpräsident Kramer:
Berlin, 28. Januar 2015. Zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung erklärt Arbeitgeberpräsident Kramer: Die Chance, in diesem Jahr ein höheres Wachstum zu erreichen, wird sich nur realisieren, wenn neue und zusätzliche Belastungen von Wirtschaft und Arbeit unterbleiben. Nur dann wird sich die gute Arbeitsmarktentwicklung fortsetzen und die Konjunktur beleben. Wir brauchen ein Belastungsmoratorium und den Abbau von Bürokratie, nicht die weitere Vermehrung von Regulierungen.
IHK-Info:
|
Vortragsabend
„Aktuelles Steuerrecht 2015“ am 10.03.2015 im RSC Nordhausen
|
|
Das
Regionale Service-Center Nordhausen der IHK Erfurt bietet wieder
gemeinsam mit Steuerberaterin Simone Rappe einen kostenfreien
Vortragsabend „Aktuelles
Steuerrecht“ mit
folgenden Themen an:
Wann: 10.
März 2015, 18:00 Uhr
(Vortrag
1 - 1,5 Stunden + Fragen / Diskussion)
Ort: Schulungsraum
des RSC Nordhausen, Wallrothstraße 4,
Interessenten
melden sich bitte unter Telefon-Nr. 03631 908210 bis
zum 25.02.2015 im
RSC Nordhausen an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Udo
Rockmann
Leiter
Regionales Service-Center
|
„Antisemitismus bedroht jüdisches Leben und Demokratie in Deutschland und Europa“
Gedenktag
für die Opfer des Nationalsozialismus: Institut für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung stellt Analysen
vor
70 Jahre nach Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz ist der Antisemitismus immer noch stark ausgeprägt und erscheint in Teilen der deutschen Bevölkerung fest verankert zu sein. „Unsere aktuellen Studien zeigen einen beachtlichen Anteil von 18 Prozent der Deut-schen, der die Auffassung vertritt: ,Durch ihr Verhalten sind Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig‘“, sagt Professor Dr. Andreas Zick, Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld. Zusammen mit Professorin Dr. Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein, einer assoziierten Wissenschaftlerin des IKG, stellte er am heutigen Holocaust-Gedenktag (27.01.2015) neue Zahlen und Ergebnisse zu antisemitischen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung vor. Professor Dr. David Schlangen präsentierte seine Analyse der Kommunikation der Pegida-Bewegung, in der laut den Forschern zunehmend auch Antisemitismus eine Rolle spielt.
„Die Zustimmung zu offenen antisemitischen Vorurteilen ist im vergangenen Jahr nach den Sommerprotesten gegen Israel erneut angestiegen. In Paris wurden im Januar Jüdinnen und Juden getötet. Wie können wir da noch ruhig der Opfer gedenken?“, fragt Andreas Zick. Laut einer Umfrage des IKG im Jahr 2014 stieg zum Beispiel die Zustimmung zu antisemitischen Einstellungen zwischen Juni und September 2014. 23 Prozent – also fast ein Viertel – der älteren Deutschen ab 60 Jahren, meint, „Juden haben zu viel Einfluss in Deutschland“. Bei den Jüngeren bis 30 Jahren ist die Zahl mit knapp zehn Prozent zwar deutlich geringer. „Sie bleibt aber seit Jahren beinahe auf einem ähnlichen Stand. Wir scheinen uns damit abgefunden zu haben“, erklärt Beate Küpper. Wie stark antisemitische Vorurteile verbreitet seien, zeige sich auch an einer Frage, die sich auf die Verfolgung und Ermordung von Juden in Nazi-Deutschland bezieht. Die Mehrheit der 2014 in der Studie „Fragile Mitte“ Befragten äußerte sich verärgert darüber, „dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden.“
„Gerade die Anti-Gaza-Demonstrationen im vergangenen Sommer haben Antisemitismus erneut auf eine erschreckende Weise aufbrechen lassen, und zwar durchaus auch in jenen Teilen der Bevölkerung, die sich selbst als Mitte versteht“, sagt Küpper.
„Der Reflex, die Geschichte der Schoah loszuwerden, erschwert das Erinnern nach Aus-schwitz“, sagt Andreas Zick. In Anbetracht der Hass-Taten gegen Jüdinnen und Juden und ihre Einrichtungen in Europa, wäre eher „ein unruhiges Erinnern“ angemessen. „Der Antisemitismus bedroht das Leben von Jüdinnen und Juden und die Demokratie in Deutschland und Europa“, sagt Zick.
Antisemitische Einstellungen treten laut Beate Küpper auch in der Pegida-Bewegung in Er-scheinung. „Pegida ist gewissermaßen ein Sammelbecken für menschenfeindliche Einstellun-gen gegenüber einer ganzen Reihe von sozialen Gruppen“, sagt Küpper. Zwar sehe man auf Pegida-Kundgebungen Israelfahnen, aber viele Europakritiker und Sympathisanten rechtspo-pulistischer Gruppen seien „mindestens klammheimlich antisemitisch“, meint Küpper unter Bezug auf empirische Befunde.
Das IKG untersucht seit zwölf Jahren die Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutsch-land. Nach Annahmen der Forscher ist dabei immer auch an den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sowie anderen Vorurteilen zu denken. Insofern ergebe es Sinn, sich Pegida genauer anzusehen, erklärt Zick.
Hintergründe zum Internet-Auftritt von Aktivisten und Sympathisanten von Pegida stellte David Schlangen vor, Computerlinguist an der Universität Bielefeld. Der Forscher hat die öf-fentliche Facebook-Kommunikation der Pegida-Bewegung untersucht. Seinen Analysen zufol-ge kommt knapp vier Fünftel der Kommentare auf der Pegida-Facebook-Seite von Konten, bei denen der dazu eingetragene Name als männlich klassifiziert werden kann. Auf der Facebook-Seite von Pegida wird auch kommentiert von Facebook-Benutzern, die auch auf der Seite der NPD aktiv sind: „Etwa 3,5 Prozent der Kommentierer auf der Pegida-Seite melden sich auch auf der Facebook-Seite der NPD zu Wort. Von ihnen stammen etwa vier Prozent der Kommentare auf der Pegida-Seite“, sagt Schlangen.
Zusatzinformation zur Verbreitung antisemitischer Einstellungen in Deutschland:
Zustimmung zu einzelnen Aussagen zur Erfassung von Antisemitismus in Prozent im September 2014
(Stichprobe: über 500 Befragte aus der deutschen Bevölkerung;
4-stufige Antwortskala, hier addiert: „ich stimme eher zu“ und „ich stimme voll und ganz zu“)
Klassischer Antisemitismus
Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss: 15%
Durch ihr Verhalten sind Juden an ihrer Verfolgung mitschuldig: 18%
Sekundärer Antisemitismus/ Schlussstrich-Mentalität
Ich ärgere mich darüber, dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden: 55%
Ich bin es leid, immer wieder von den deutschen Verbrechen an den Juden zu hören: 49%
Israelbezogener Antisemitismus
Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer: 20%
Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat: 28%
NS-vergleichende Israelkritik
Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser: 40%
Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben: 27%
Quelle: Zusatzerhebung zur Studie „Fragile Mitte – Feindselige Zustände“, durchgeführt von Andreas Zick und Anna Klein im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, auf Grundlage von Tabelle 4.2.1.
Sandra Sieraad Pressestelle, Universität Bielefeld
Eine
Mitteilung des idw – wissenschaftlichen Dienstes am 27.01.2015
Dienstag, 27. Januar 2015
Winterferienaktion in der FLOHBURG | Das Nordhausen Museum
Nordhausen (psv) Das stadthistorische
Museum FLOHBURG bietet in den Winterferien in der Zeit vom 3. bis 6.
Februar von 10 bis 17 Uhr zwei Aktionen an.
Die erste Ferienaktion heißt „Mit
Federkiel auf Pergament!“. „Gemeinsam schreiben wir historische
Schriften mit Gänsefedern und Tinte!“, sagt Museumsmitarbeiterin Astrid
Lautenschläger. „In unserer Schreibstube
zeigen wir, wie
vor 500 Jahren geschrieben wurde. Nur sehr wenige Menschen konnten
damals lesen und schreiben. Mit viel Können und Talent kopierten Mönche
in Klöstern seit der Spätantike die alten Schriften im sogenannten
‚Skriptorium‘. Mit ein wenig Geschick kann das jetzt
jeder selbst einmal probieren.“
„Wer dazu keine Lust hat, kann aber auch
mit uns auf ‚FLOHBURG-Entdeckertour‘ durch das Museum gehen“, sagt Frau
Lautenschläger. Hier lernen die Ferienkinder viel Wissenswertes über die
Geschichte der Stadt. Zur Tour gibt es Entdeckertour-Heftchen,
dessen witzige Fragen und eine kleine Überraschung im Anschluss viel
Spaß machen werden, verspricht sie.
Voranmeldungen nimmt das Team der Flohburg, in der Barfüßerstraße 6, gern auch telefonisch unter 03631 / 4725680 oder per Mail:
flohburg@nordhausen.de entgegen. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Person 2,50 €.
Foto: Schon im Vorjahr wurde im Skriptorium der Flohburg fleißig wie vor 500 Jahren geschrieben. (Foto: Astrid Lautenschläger)
Primas: Aufklärung über Ursachen und Einsatzpraxis ist das Gebot der Stunde
Verbraucher
schützen – Antibiotikaeinsatz reduzieren
Nach den Worten des Agrarexperten Primas muss immer wieder verdeutlicht werden, was die möglichen Konsequenzen des Antibiotikaeinsatzes bei Nutztieren sind und worüber es aufzuklären gilt: „Wenn wir die aktuelle Debatte sinnvoll nutzen und als Chance begreifen wollen, dann müssen wir mit allen Beteiligten über Tiergesundheit, Hygiene, Impfprogramme, Haltungsbedingungen und vieles mehr diskutieren, um die Ursachen des Problems zu erfassen und abstellen zu können, anstatt den Arzneimitteleinsatz per se anzuprangern“, sagte der Agrarexperte.
Der Beschluss vom Herbst 2012 berücksichtige einen ganzheitlichen Ansatz bei der Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes, etwa Hygienemaßnahmen, Impfprogramme, Veränderungen der Haltungsbedingungen und andere präventive Maßnahmen. „Es ist gut, wenn wir im Landtag diskutieren, in welchem Ausmaß die damalige Willensäußerung des Parlaments umgesetzt werden konnte und wo eventuell nachgesteuert werden muss. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Klarheit zu schaffen und das Vertrauen der Verbraucher zu sichern – das ist das Gebot der Stunde“, so Primas abschließend.
Dr. Karl-Eckhard Hahn
Pressesprecher
Sammler werden belohnt
Manon-Quartett wirbt für Opernpremiere – Wer alle Spielkarten findet, kann Theaterkarten gewinnen
Eine
Schlüsselszene der Oper „Manon“, die am Freitag, 30. Januar, Premiere
im Theater Nordhausen hat, findet in einem Spielcasino statt: Manon
überredet ihren Geliebten des Grieux, sein Glück beim Kartenspiel zu
versuchen. Doch das wird ihnen zum Verhängnis …
Auch
für Nordthüringer Opernfreunde können Spielkarten nun Glück bringen:
Mit einem „Manon-Quartett“
wirbt das Theater Nordhausen für die
gefühlvolle Oper voll berührender Melodien. Mit den Fotos der drei
Hauptdarsteller wurden drei Spielkarten produziert: Elena Puszta als
Manon ist die Herzdame, Martin Shalita – Manons Geliebter des Grieux –
der Herzbube, und Laurence Meikle, sein Rivale de Brétigny fungiert als
Herzkönig. Das Plakatmotiv zu „Manon“ prangt auf dem Ass.
Nach
und nach und in verschiedener Stückzahl tauchen die Spielkarten überall
dort auf, wo Informationsmaterial des Theaters Nordhausen zu finden
ist. Fleißige Sammler werden belohnt: Wer alle vier Karten gesammelt
hat, kann diese an der Theaterkasse abgeben und mit etwas Glück
Theaterkarten gewinnen. Einsendeschluss ist der 19. April, der Tag der
letzten „Manon“-Vorstellung.
Wer
sich nicht auf das Glück verlassen möchte, erhält Eintrittskarten für
die Oper „Manon“ – die Premiere am 30. Januar um 19.30 Uhr und die
nächsten Vorstellungen am 8. Februar um 18 Uhr und am 21. Februar um
19.30 Uhr – an der Theaterkasse (Tel. 0 36 31/98 34 52), im Internet
unter www.theater-nordhausen.de und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.
Foto: Das komplette „Manon“-Quartett; Foto: Birgit Susemihl
Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus:
Zeh: „Wer auf Radikalisierung setzt, sei auf das Grundgesetz verwiesen“
Nordhausen (psv)
Mit einer
Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof gedachte heute Nordhausen den
Opfern des Nationalsozialismus. In seiner Rede mahnte Dr. Zeh: „Egal,
wer auf Radikalisierung setzt, der sei auf das Grundgesetz
verweisen.“
Zeh
verwies darauf, dass Nordhausen – als früherer Standort eines
Konzentrationslagers – eine besondere Verantwortung habe, das
Vermächtnis der getöteten und überlebenden
Häftlinge zu bewahren.
Kränze
legten u.a. die amtierende Landrätin Jutta Krauth nieder, Vertreter der
Fraktionen in Stadtrat und Kreistag, der jüdischen Gemeinde, der
Kirchen sowie der Vereine
und Verbände.
Hier die Rede des Oberbürgermeisters im Wortlaut.
Sehr
geehrte Damen und Herren, wir gedenken heute, am 27. Januar, der
Millionen Opfer und Überlebenden
in den deutschen Konzentrationslagern. Dieser Tag wurde von
Bundespräsident Roman Herzog als Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus gewählt, weil am 27. Januar 1945 das
Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit wurde.
Dieser
Tag ist auch für unsere Stadt ein besonders wichtiger Tag. Auch
Nordhausen war über Jahre hinweg
der Standort eines Konzentrationslagers. Mit und von diesem Lager hat
Nordhausen gelebt. Deshalb ist es auch um so wichtiger, dass wir in
jedem Jahr hier zusammenkommen.
Angesichts
des Grauens und der schrecklichen Bilder, die von Ausschwitz auch an
diesem Gedenktag uns immer
wieder ins Gedächtnis gerufen werden, fehlt uns die Fähigkeit, diese
Hölle in Worte zu fassen. Deshalb will ich mit den Worten eines
Gedichtes des deutschen Literaten Werner Bergengruen beginnen. Er
schrieb es 1945 in „Die letzte Epiphanie“:
„Ich hatte dieses Land in mein Herz genommen.
Ich habe ihm Boten um Boten gesandt
In vielen Gestalten bin ich gekommen
Ihr aber habt mich in keiner erkannt.
Ich klopfte bei Nacht, ein bleicher Hebräer,
ein Flüchtling, gejagt mit zerrissenen Schuhn.
Ihr riefet den Schergen, ihr winktet dem Späher
Und meintet noch, Gott einen Dienst zu tun.
Ich kam als Gefangener, als Tagelöhner;
Verschleppt und verkauft, von der Peitsche zerfetzt.
Ihr wandet den Blick von dem struppigen Fröner
Nun komm ich als Richter. Erkennt ihr mich jetzt?“
Mit
seinem Gedicht hat Bergengruen den Deutschen den Spiegel vorgehalten.
Die Deutschen waren verblendet,
aufgehetzt und verzerrt vom Hass. Sie haben das Wesentliche nicht mehr
sehen wollen: Den Menschen mit seiner unantastbaren Würde.
Eugen Kogon, selbst KZ-Häftling, deutscher Patriot, und später einer der geisteigen Väter des Grundgesetzes
sowie Autor des Buches „Der SS-Staat“ schreibt dort unmittelbar nach dem Kriegsende:
„Der
durchschnittliche Deutsche wusste nichts davon, dass Gott uns in
Menschengestalt zu erscheinen pflegt,
in der Gestalt des „geringsten seiner Brüder und Schwestern“, um uns
auf die erlösende Probe der einfachen Menschlichkeit zu stellen.
Wir
können Deutsche, Amerikaner, Engländer, Franzosen sein, aber vor dem
höheren Forum nur so lange, als
wir dabei nicht vergessen und verlernen, zuallererst Menschen zu sein.
Ich meine, das deutsche Volk sollte mit jener Objektivität, die es
auszeichnet, lesen, was in den Prozessakten der Wahrheit als ermittelt
und bezeugt geschrieben steht, und dann sich selber
fragen:
Wo waren wir hingeraten? Wie war das möglich? Was können wir tun, um vor uns selbst und der Welt zu bestehen?“
Diese
Worte von Eugen Kogon haben heute große Aktualität erhalten: Unser Land
ist in Bewegung, tausende
von Menschen sind auf den Straßen. Die Beweggründe sind zwar diffus,
doch umso schärfer muss die Grenze sein. Sie verläuft genau dort, wo
eine Gruppe von Menschen, nämlich Minderheiten, zu Sündenböcken gemacht
werden soll. Die Mehrheit der Muslime kann nichts
für mordende islamistische Fanatiker, genauso wenig wie die Flüchtlinge
aus den arabischen Ländern, die um ihr Leben bangen müssen. Diesen
Menschen kämpfend um die nackte Existenz – diesen müssen wir Asyl
gewähren!
Das ist Deutschlands menschliche und ethische Verpflichtung. Und diese Differenzierung sollte sowohl bei
den Pegida-Demonstrationen klar gemacht werden wie bei jenen, die unter Missbrauch von Religion morden.
Und
wer es nicht verstehen mag, wer auf Radikalisierung setzt, der sei
nachdrücklich auf das Grundgesetz verwiesen: Dort stehen die
entscheidenden Sätze. Sie gelten,
Wort für Wort, und Wort für Wort sind sie verbindlich und einklagbar:
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2)
Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen
Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
Im
April werden wir den 70. Jahrestag der Befreiung des KZ „Mittelbau
Dora“ begehen. Für viele der Überlebenden wird es aufgrund des Alters
der letzte Besuch an der Nordhäuser
Leidensstätte sein. Damit wächst unserer Verantwortung: Wir werden das
Vermächtnis der Ermordeten und der Überleben antreten- und vor allem
bewahren müssen. Lassen Sie uns nun jener gedenken, die der Hölle der
Konzentrationslager nicht entkommen konnten und
die auch hier beigesetzt sind.
Abonnieren
Kommentare (Atom)